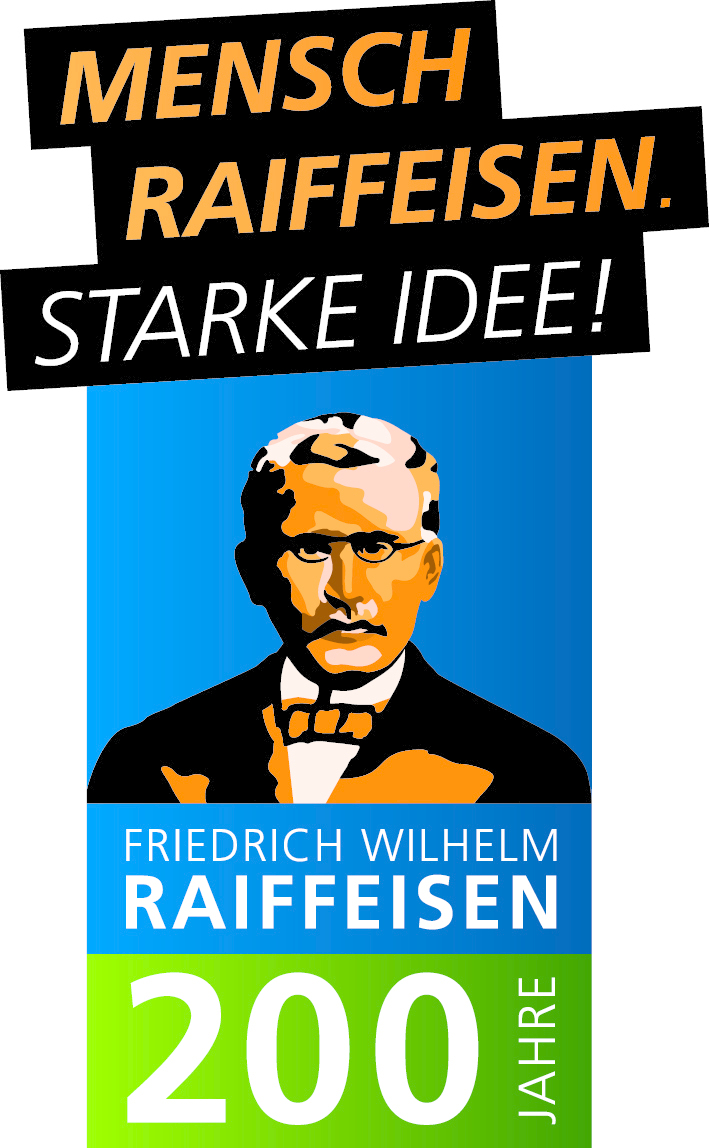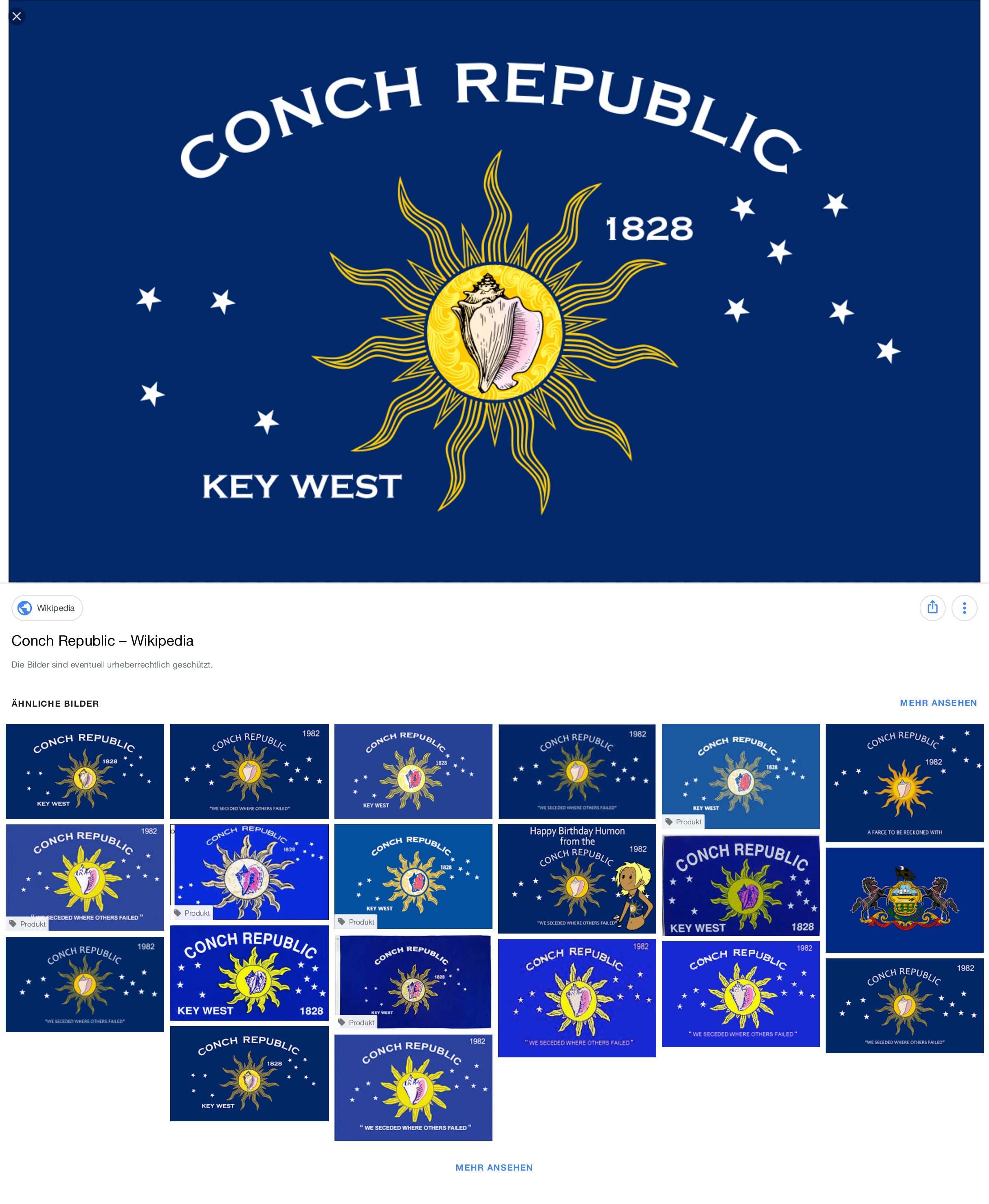Etablierte Medien vom Sozialismus durchsetzt
Ein guter Freund wies mich auf einen Artikel über die Hausbesetzerszene in Berlin hin. Er kritisierte, dass in der Bild-Zeitung über die Räumung eines besetzten Hauses in der Bornholmer Straße berichtet wurde, weil die Straftäter als Aktivisten bezeichnet worden: „Aktivisten besetzten am Pfingstsonntag insgesamt neun Wohnhäuser“. Ich gab ihm Recht. Die Verwahrlosung der Sprache, ausgerechnet in der präzisen Bild, gibt einen Einblick in die aufgeweichten Hirne von Journalisten – vom Sozialismus zersetzt oder besetzt? Ein …